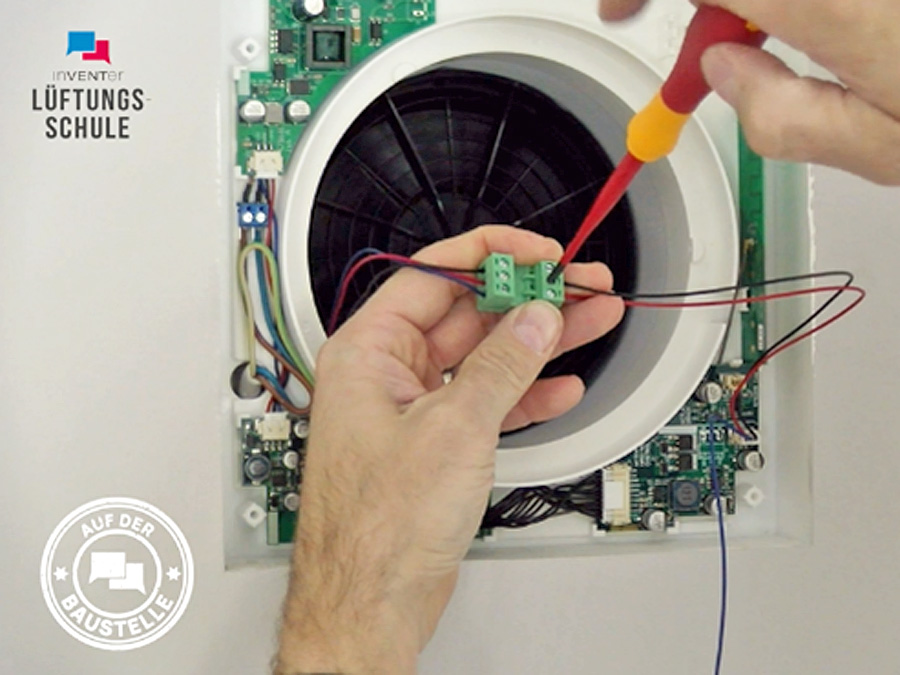Vier fahren vorVW „Caddy“, Fiat „Doblò“ mit Erdgas, Mercedes „Vito“ sowie Renault „Master“ im Test
Zwei Modelle aus der Lieferwagenklasse präsentieren sich auf der Höhe der Zeit: Volkswagen hat seinen „Caddy“ an das neue Outfit der VW-Familie angeglichen und unter der Haube alle Motoren Euro5-tauglich gemacht. Als besonders schadstoffarm ist der Fiat „Doblò“ dank Erdgas-Turbo unterwegs. Zwei Modelle in der Transporterklasse sind ebenfalls mit Euro5 konform: Der kompakte Mercedes „Vito“ sowie der Renault „Master“ können Erwartungen für mehr Laderaum und höhere Nutzlasten erfüllen. IKZ-HAUSTECHNIK-Autor Thomas Dietrich hat die Vier in Tests „erfahren“ und ist dabei Stärken und Schwächen begegnet.
Volkswagen „Caddy“
Volkswagen macht jetzt auch beim „Caddy“ visuell deutlich, dass der Lieferwagen typisch VW ist. Doch das mag für den Interessenten kaum ein Kaufargument sein. Vielmehr ist das Motorenangebot gründlich überarbeitet worden. Das Ergebnis: Euro5 gilt für alle Aggregate, von denen sich einige spürbar sparsamer und kultivierter bemerkbar machen. Testfahrten mit verschieden starken Diesel-Varianten zeigten, dass das bislang typische Rasseln oder Nageln verschwunden ist.
Volkswagen „Caddy“: Plus & Minus
+ Euro5-Motoren
+ Modernes Fahrzeugkonzept auf Pkw-Niveau
+ Frachtraumgrößen 3,2 bzw. 4,2 m³
+ Mehr als 700 kg Nutzlast möglich
+ Beim Kombi alle hinteren Sitze herausnehmbar
+ Ausreichende Sitzfreiheit und passable Gestaltung des Fahrerplatzes
+ Fahrkomfort ausgewogen
+/- Außenspiegel mit guter Sicht (links mit Weitwinkelsegment), im Fahrtwind jedoch zu laut
+/- Verzurrösen nur am Frachtraumboden
+/- Arretierung der Hecktüren
+/- Werkseitig nur spärlicher Schutz der Frachtraumwände
+/- Lang-Version ohne große glattgezogene Seitenflächen
- Scheibenwischer lassen sich zum Enteisen nicht abklappen
- Geöffnete Schiebetür rastet nicht sicher ein
Vier Diesel-Motoren zwischen 55 kW/75 PS
und 102 kW/140 PS dürften typische Nutzererwartungen erfüllen. Bei höheren Leistungen gibt es ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder alternativ ein automatisiertes Direktschaltgetriebe (DSG). Die verbrauchsoptimierte BlueMotion-Technologie für die beiden schwächeren TDI gibt es dagegen stets mit 5-Gang-Handschaltung. Der Diesel mit 75 kW/102 PS erreicht dabei laut Werk einen Norm-Verbrauch von 4,9 l auf 100 km (129 g/km CO2). Wer eine Allradversion braucht, kann den „Caddy“ 4Motion beispielsweise mit dem 81 kW/110 PS Diesel plus 6-Gang-Getriebe ordern (Mehrverbrauch: ca. 1 l/100 km).
Eine Leerfahrt im normalen „Caddy“ mit der schwächsten 55-kW-Version erweist sich in der Beschleunigung als mäßig. Gleiches ist beim 47 cm längeren „Caddy Maxi“ festzustellen, dessen Einstiegs-Diesel 75 kW/102 PS leistet. Für Dienste rund um den Kirchturm mag dies manchem Handwerker dennoch reichen. Auffallend die geringe Geräuschentwicklung selbst bei 120 km/h, die weniger von den kultivierten und geräuschgedämmten Motoren kommt als von Wind und Reifen.
Um das Motorenangebot komplett zu machen: Neben den beiden Benzinern mit 63 kW/
86 PS sowie 77 kW/105 PS gibt es weiterhin den Erdgasmotor mit 80 kW/109 PS.
Neue Ausstattungslinien
VW bietet den normalen sowie den langen „Caddy“ als Kastenwagen oder Kombi in Standard-Ausstattung, die durch viele Optionen aufgewertet werden kann. Parallel dazu gibt es beide „Caddy“ in Pkw-Ausstattung. Wichtig beim Kombi: Jetzt kann die asymmetrische Sitzreihe hinter dem Fahrer in zwei Einheiten ohne Mühe ausgebaut werden. Auch beim sonst gut eingerichteten Fahrerplatz wurde nachgebessert: Endlich hat das Rot in den Instrumenten einem klaren Weiß Platz gemacht.
Frachträume unverändert
Im Nutzfahrzeugprogramm des „Caddy“ bleibt es bei den bekannten Laderäumen: Mit 4,2 m³ ist das Frachtraumvolumen des „Caddy Maxi“ angegeben – 1 m3 mehr als beim normalen Kasten. Dank Flexsitz-Plus schafft es der „Maxi“ sogar, dass bei geschwenkter Trennwand und geklapptem Beifahrersitz nochmals 0,5 m3 mehr hineinpassen bzw. Ladelängen bis zu 3 m realisiert werden können. Heckklappe oder Flügeltüren gibt es ohne Aufpreis wahlweise, doch nicht bei allen Varianten. Die maximale Nutzlast beim normalen „Caddy“ liegt bei 740 kg, im „Maxi“ dürfen noch ca. 70 kg mehr an Bord.
Als langer Kasten mit Normaldach bringt es dieser Fiat „Doblò Cargo“ auf ein Ladevolumen von 4,2 m³ hinter der Trennwand. Die Erdgas-Variante bietet eine Nutzlast von 905 kg.
Fiat „Doblò“ mit Erdgas
Ein erster Fahrbericht hat sich bereits mit zwei der inzwischen drei möglichen Diesel-Aggregaten auseinandergesetzt (IKZ-HAUSTECHNIK 18-2010, S. 92). Jetzt soll die mit Euro5-konforme Erdgas-Variante im Mittelpunkt stehen. Fiat hat seit Jahrzehnten Erfahrungen mit diesem Kraftstoff, einen entsprechend großen heimischen Markt und die attraktive Turbo-Technik vom Transporter „Ducato“ auf die nächst kleinere Nutzfahrzeugklasse erweitert. Vorbei ist es da mit dem Image eines schwächelnden Öko-Antriebs. Der bivalente Otto-Motor leistet entweder im Benzin-Modus 88 kW/120 PS oder bietet im Erdgas-Betrieb 85 kW/115 PS. Laut Werk liegt der Wert für den CO2-Ausstoß im Erdgas-Betrieb bei 134 g/km. Durch die Aufladung reduziert sich der Norm-Verbrauch des Fiat „Doblò Natural Power“ jetzt auf angegebene 4,9 kg Erdgas pro 100 km.
Fiat „Doblò Cargo“ (Erdgas): Plus & Minus
+ Neuzeitliches Lieferwagenkonzept mit drei Karosserievarianten
+ Ladevolumen bis 4,2 m³ im Frachtraum
+ Nutzlast des Erdgas-Frachters 905 kg
+ Trennwand oder Schwenkgitter plus klappbarem Beifahrersitz möglich
+ Variantenreiches Motorenkonzept erfüllt Euro5
+ Interieur auf Pkw-Niveau
+ Gutes Handling bei kurzem und langem Radstand
+ Niedriges Geräuschniveau mit 6-Gang-Getriebe
+ Erdgas-Reichweite 300 bzw. 400 km
+/- Erdgas-Turbo entfaltet Leistung erst oberhalb von 2200 Touren
+/- Keine Verzurrmöglichkeiten im mittleren und oberen Frachtraumbereich
+/- Außenspiegel lassen großen Toten Winkel zu
- Funkfernbedienung öffnet Front- und Hecktüren getrennt – hinderlich
- Geöffnete Schiebetür verriegelt nicht sicher
Beim normalen Radstand sind es vier Stahlflaschen unter dem Fahrzeugboden mit einem Energievorrat von ca. 16 kg Erdgas (Reichweite etwa 300 km). Die Lang-Version kommt durch eine fünfte Komponente auf ca. 22 kg Erdgas (Reichweite rund 400 km). Gesamt-Reichweiten mit dem zusätzlich vorhandenen 22 l fassenden Benzintank anzugeben, verbietet sich an dieser Stelle ebenso wie die Höchstgeschwindigkeit zu nennen. Den Fahrer eines Erdgasfahrzeuges zeichnet schließlich eine vorausschauende Fahrweise ohne Bleifuß aus – sonst würde das umweltbewusste Antriebskonzept auf den Kopf gestellt.
Dank Turbo bietet Erdgas Leistung
Wie flott der Erdgas-Turbo unterwegs sein kann, zeigte sich bei der Testfahrt. Zuerst aber eine Enttäuschung: Unterhalb von 2000 Touren offenbaren sich nur mäßige (aber sicher energiesparende) Fahrleistungen – von einem wirksamen Drehmoment sollte man nicht sprechen. Wenn der Drehzahlmesser jedoch 2000 Umdrehungen überschritten hat, erwacht das italienische Temperament im Triebwerk. Ob City oder Autobahn: Mühelos kann man im fließenden Verkehr mithalten oder sogar den Ton angeben. Das kann geräuscharm sein, denn dank 6-Gang-Getriebe wirken bei 120 km/h weder Drehzahl (3000 Touren) noch Abrollgeräusche aufdringlich. Die Wendigkeit bei Kurz- und Lang-Version (Wendekreis 11,2 bzw. 12,5 m) hat der „Doblò Cargo“ von der ersten Generation geerbt.
Drei verschiedene Frachtraum-Varianten
Durch die Unterflur-Anordnung der Erdgastanks bleibt es bei den üblichen Lade-Volumina: Der kurze Kasten mit Normaldach bringt es auf 3,4 m³. Länge x Breite x Höhe im Frachtraum ist dabei mit 1824 x 1230/1480 x 1300 mm angegeben. Ordert man ein schwenkbares Trenngitter plus den klappbaren Beifahrersitz, können 3,6 m³ drin sein. Beim Hochdach (nur kurzer Radstand) steigt die Ladekapazität auf 4,0 bzw. 4,2 m³, wenn statt Beifahrer Fracht mitgenommen werden soll. Die Lang-Version mit Normaldach (Radstand 3105 mm) kann mit seinem 35 cm längeren Frachtraum 4,2 m³ hinter der Trennwand aufnehmen. Der Erdgas-„Doblò“ verkraftet bei einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 2,4 t mit beiden Radständen 905 kg Nutzlast (Fahrer nicht eingerechnet).
Beim Fiat „Doblò Cargo Natural Power“ ist die Schiebetür auf der Beifahrerseite stets vorhanden. Leider verriegelt sie in geöffneter Endstellung nicht sicher, sodass sie z. B. bei Gefälle unbeabsichtigt zurollen kann. Die Pkw-Versionen haben diese Sicherheitsfunktion.
Mercedes „Vito“
Beim „Vito“ sind es neugestaltete Klarglas-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht und ein markanter Mercedes-Grill mit zwei Querspangen, die den kompakten Transporter im Modelljahr 2011 äußerlich kennzeichnen. Die Modernisierung im Verborgenen ist dagegen wesentlich aufwendiger: Verbrauchsreduzierte Euro5-Motoren sowie ein neu abgestimmtes Fahrwerk beschleunigen den Transporter in die Neuzeit. Maße und Gewichte sind weitgehend unverändert geblieben. Den 2,8- bis 3,2-Tonner gibt es weiterhin in drei Längen. Das Ladevolumen staffelt sich beim Kasten mit Normaldach von 5,2 m³ über die Langversion mit 5,7 m³ bis zu 6,2 m³ (extralang). Bei einem Hochdach können sogar 7,4 m³ drin sein. Die Nutzlast lässt sich je nach Ausführung von etwa 900 kg auf 1345 kg steigern. Es bleibt beim Heckantrieb mit bekannt alltagstauglichem Wendekreis von 11,8 m (Radstand 3200 mm) und auch die Allrad-Option ist weiter verfügbar.
Mercedes „Vito“: Plus & Minus
+ Laufruhige, im Verbrauch reduzierte Euro5-Motoren
+ Blue-Efficiency-Paket für weitere Verbrauchsreduzierung als Option
+ Optimierter Antriebsstrang senkt Geräuschverhalten
+ Fahrwerk spürbar komfortabler als bisher
+ Zulassung als 3,2-Tonner möglich
+ Drei Fahrzeuglängen sowie Hochdach-Variante
+ Aufgewertete Cockpit-Ausstattung mit zahlreichen Ablagen am Fahrerplatz
+ Frachtraumverkleidung als Standard nur halbhoch, doch funktionale Ausbaupakete ab Werk
+/- Massive A-Säulen in Kombination mit den Außenspiegeln schränken Sicht ein
+/- 6-Gang-Handschaltung arbeitet etwas schwerfällig
+/- Hecktüren nur als Option
+/- Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten (mit erheblichen Aufpreisen)
+/- Verzurrösen nur im unteren Frachtraumbereich als Standard
- Scheibenwischer lassen sich zum Enteisen nicht abklappen
- Voll geöffnete Schiebetür verriegelt nicht sicher
Bewährte Technik aus dem Sprinter
Unter der Motorhaube hat der „Vito“ allerdings eine Kernsanierung erfahren. Die in den letzten sieben Jahren tätige Antriebstechnik musste Neuerungen weichen, die sich seit dem Frühjahr 2009 bereits im Sprinter bewähren. Es sind die Euro5-tauglichen Dieselmotoren der Baureihe OM 651, die als Vierzylinder in den Leistungsstufen 70 kW/95 PS, 100 kW/136 PS sowie 120 kW/163 PS auf den „Vito“ zugeschnitten sind. Zwei V6-Triebwerke, ein Diesel mit 165 kW/224 PS sowie ein Otto mit 190 kW/258 PS, bilden die Top-Motorisierungen, die nur mit Automatikgetriebe zu haben sind. Die Fahrer der restlichen „Vito“-Modelle können vom 6-Gang-Getriebe (EcoGear) profitieren, das dank weit gespreizter Übersetzung bis zu 15 % vom bisherigen Dieselverbrauch einsparen kann. Eine weitere Verbrauchsminderung um 0,3 l soll das Blue-Efficiency-Paket bringen. Dazu gehören Start-Stopp-Funktion, Schaltanzeige sowie rollwiderstandsarme Reifen.
Doch nicht nur der komplette Antriebsstrang wurde modifiziert, auch das Fahrwerk ist neu abgestimmt und je nach Modell konsequent auf die Beförderung von Gütern oder (etwas komfortabler) auf Personen ausgelegt. Das Ergebnis der Tests: Die Laufruhe der 2,1-l-Motoren und die geringen Geräuschemissionen während der Fahrt durch Stadt und Land werten den „Vito“ eindeutig auf.
Stärkere Diesel für höhere Nutzlasten
Das Einstiegsmodell 110 CDI mit 95 PS (CO2-Emission bei normalem Kasten: max. 211 g/km) verfügt über ein Drehmoment von lediglich 250 Nm. Das mag für manche City-Baustelle genügen, doch bei Fahrten über weitere Distanzen und bei hohen Zuladungen sollten es mindestens die 310 Nm des 113 CDI sein (CO2-Emission bei normalem Kasten: max. 203 g/km).
Neue Reflexionsscheinwerfer rahmen den Kühlergrill ein. Optional ist der „Vito“ der neuen Generation mit einer Kombination von Bi-Xenon-Scheinwerfern, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht und statischem Kurvenlicht sowie einer Scheinwerfer-Reinigungsanlage lieferbar. Ebenfalls neu gestaltet ist der vordere Stoßfänger des „Vito“.
Renault „Master“ (Heckantrieb)
Der neue „Master“ kann in der Transporter-Klasse von 3,3 bis 4,5 t zulässigem Gesamtgewicht vielen unterschiedlichen Nutzern gerecht werden. Nicht genug mit drei Radständen, vier Fahrzeuglängen, drei Laderaumhöhen und drei Leistungsstufen. Allein dies macht es möglich, dass ein paar Hundert Varianten gefertigt werden können. Neben frontgetriebenen Varianten bietet das Nutzfahrzeugkonzept auch Alternativen mit Heckantrieb, auf die sich dieser Fahrbericht konzentriert. Wählbar sind Frachträume mit einer Ladelänge von max. 4,40 m und Volumina von nahezu 17 m³ können erreicht werden (mit Kofferaufbau 22 m³).
Renault „Master“ (Heckantrieb): Plus & Minus
+ Zwei geräuscharme Motoren (Euro5-Zulassung möglich)
+ Zulassung als 3,5- oder 4,5-Tonner
+ Zwillingsbereifte Hinterachse gegenüber Frontantriebler um 1100 kg höher belastbar
+ Anhängelast bei Zwillingsbereifung bis 3 Tonnen möglich
+ Cockpit-Ausstattung mit zahlreichen Ablagen am Fahrerplatz
+ Beifahrersitzbank variabel als Arbeitstisch nutzbar
+ Frachtraumverkleidung als Standard nur halbhoch, doch funktionale Ausbaupakete ab Werk
+/- Bei hohen Nutzlasten wäre stärkerer Motor wünschenswert
+/- Weniger agiles Fahrverhalten als bei frontgetriebenen Versionen
+/- Weitwinkelsegment im Außenspiegel bietet schlechte Sicht, nicht verstellbar
- Warnblinktaste nahe Rückspiegel deplatziert
Mit der Karosserievariante L4H2 (langer Radstand mit Überhang, Stehhöhe 180 cm im 438 cm langen Frachtraum) lässt sich beispielsweise ein Ladevolumen von 14,9 m³ realisieren. Um Platz für den Heckantrieb unter dem Laderaum zu schaffen, verringert sich die Frachtraumhöhe gegenüber einem Frontantriebler um 10 cm. Die maximale Laderaumbreite von 176 cm reduziert sich zwischen den Radkästen bei einer Zwillingsbereifung auf 108 cm (statt 138 bei Einzelbereifung). An maximaler Nutzlast sind beim 3,5-Tonner etwa 1,3 Tonnen (Einzelbereifung) bzw. 1087 kg (Zwillingsbereifung) möglich.
Wann aber spielen die Zwillingsreifen ihren Trumpf aus? Bei der möglichen Anhängelast ergeben sich bessere Werte: Statt 2500 kg sind es 500 kg mehr. Noch besser punkten kann der zwillingsbereifte Heckantrieb beim 4,5-Tonner, denn dann darf die Hinterachse (statt mit 2300 kg) mit 3200 kg belastet werden. Nebenbei bemerkt: Ein einzeln bereifter Frontantriebler darf auf der Hinterachse max. 2100 kg tragen.
Was die Ausstattung der Frachträume anbelangt, gibt es jetzt weit mehr als die halbhoch verkleidete Billig-Variante. Gleich beim Kauf lassen sich Ausbau-Pakete wählen, die z. B. großflächige Verkleidungen mit integrierten Verzurrleisten in mittleren und oberen Bereichen aufweisen und werkseitig eingebaut werden.
Diesel mit Option für Euro5
Die Vierzylinder-Common-Rail-Diesel (2,3 l Hubraum) sind grundsätzlich für Euro5 vorbereitet und benötigen dafür lediglich noch den Dieselpartikelfilter. Für den Heckantriebler gibt es die beiden Leistungsstufen 92 kW/125 PS sowie 107 kW/145 PS. Standard ist ein manuelles 6-Gang-Getriebe, alternativ ein automatisiertes Schaltgetriebe.
Auf der Testfahrt ging es zunächst mit dem 125-PS-Diesel in Kombination mit langem Radstand plus Überhang und mittelhohem Dach (L4H2) sowie einer Nutzlast von 800 kg. Aufgrund der kurzen Übersetzung des 6-Gang-Getriebes ließ sich auf Fahrten durch City und Umland in den kleinen Gängen gut mithalten, nicht aber auf der Autobahn. Dreht der Motor 2000 Touren im 6. Gang und das Gaspedal fordert Leistung, bleibt dies nahezu wirkungslos, denn das max. Drehmoment von 310 Nm bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die 350 Nm der stärkeren Diesel-Variante sind da das Minimum, wie sich bei nachfolgenden Testmöglichkeiten mit dem 145-PS-Aggregat zeigte. Der Verbrauch liegt gegenüber einem Frontantriebler knapp 1 l höher: Mit 9,2 l auf 100 km ist der Drittelmix angegeben und die CO2-Werte liegen bei min. 243 g/km (Werksangaben für die 125-PS-Version).
Behäbige Schaltvorgänge nötig
Bei der Zwillingsbereifung erreicht der heckgetriebene „Master“ einen stolzen Wendekreis von 15,7 m, während ein Frontantriebler mit 13,6 m auskommen kann. Was beim Heckantrieb noch auffällt: Die Schaltvorgänge brauchen mehr Zeit und das Handling insgesamt ist im Vergleich zum agilen Frontantriebler spürbar behäbiger.
Wichtiges Nachschlagewerk
Online lassen sich Infos zu den derzeit 900 Erdgastankstellen in Deutschland sowie weitere in den Nachbarländern tagesaktuell einholen. Und auf Reisen hilft das 322 Seiten starke Ringbuch weiter. Die Nutzer des Wegweisers profitieren unter anderem von Umgebungskarten mit exakter Position der Erdgastankstelle und Richtungshinweisen, Öffnungszeiten und Zahlungsmöglichkeiten sowie der angegebenen Entfernung zu nahe gelegenen Autobahnen. Einzelexemplare für netto 12 Euro über die Info-Hotline Erdgasfahrzeuge 01802/1440000 oder über www.gas24.de

Wo liegt die nächste Erdgas-Tankstelle? Deutschland und die europäischen Nachbarn sind im Ringbuch übersichtlich zusammengefasst.
Bilder: Soweit nicht anders angegeben: Thomas Dietrich
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de
www.fiat-professional.de
www.daimler.de
www.renault.de