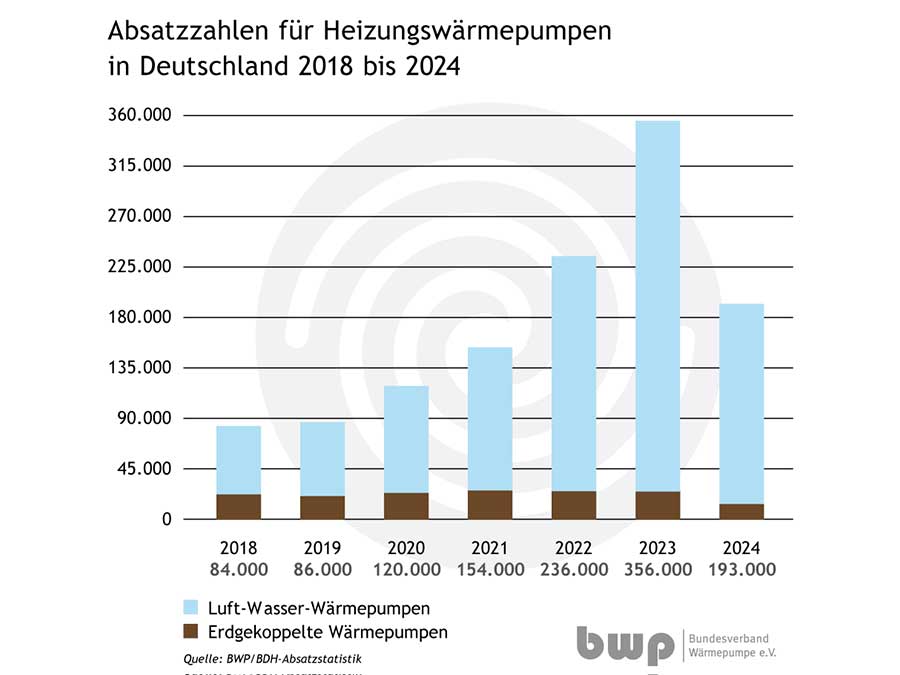Taktischer Rückzug
Die Solarthermie kann vom Dach an die Fassade wandern, ohne zu verlieren
Die Photovoltaik gewinnt im Ringen mit ihrer Schwester Solarthermie um die knappen Dachflächen. Muss die sich zurückziehen? Eine Rückzugsoption ist vorhanden: Sie könnte die Fassade in Anspruch nehmen. Lösungen dafür gibt es genug. Planer sollten mehr in diesen Alternativen denken.
Was, wenn die Solarthermie damit rechnen muss, ihren Platz auf der knappen Dachfläche an die Photovoltaik (PV) zu verlieren? Die PV wird sich entgegen weiter sinkender Einspeisevergütungen über die Eigenstromversorgung am Markt behaupten. Experten schätzen, dass bereits in diesem Jahr 50 % aller neu installierten PV-Anlagen eine Solarbatterie haben. Der Trend geht in Richtung 100 %.
Die zweite Wandlung ist, dass PV-Anlagen als Hybridsystem (in Kombination mit Wärmepumpen) in die Wärme- und Kälteversorgung eines Gebäudes einziehen. Zwar ist diese Systemtechnik noch sehr teuer im Vergleich zu konventionellen Wärmeerzeugern. Aber sie gewinnt an Aufmerksamkeit bei Bauherren und Hausbesitzern. Außerdem fallen die Anlagenpreise für PV weiter, während die Öl-, Strom- und Gaspreise langfristig steigen.
Hinzu kommt: In der öffentlichen Wahrnehmung wird Solarenergie meist mit PV verbunden. Die Solarthermie führt im Licht von PV ein Schattendasein. Seit 2008 schrumpft der Solarwärmemarkt.
Fassadenkollektor bedarfsgerechter?
Wer verdrängt wird, sucht nach neuen Orten. Für die Solarthermie könnte die Rückzugsfläche die Fassade sein, auf der sie in Zukunft in Co-Existenz zur PV lebt. Zwar ist der Solarertrag bei einem Fassadenkollektor gegenüber einer Dachanlage um ca. 30 % geringer. Doch Solarwärmeanlagen an der Fassade können zum Beispiel hervorragend die tief stehende Sonne nutzen – und damit mehr Ertrag im Winter liefern. Also dann, wenn Raumwärme wirklich gefragt ist. Sie fangen überdies diffuses Licht besser ein – auch eines der Kennzeichen der Sonne an Wintertagen, z. B. über Reflexionen.
Der Solaranteil an der Wärmeversorgung eines Gebäudes kann mit einem Fassadenkollektor deutlich über 50 % betragen. Unterm Strich geht es immer um die Frage der nachfrageorientierten Bereitstellung und nicht um absolute Ertrags-Zahlen. So nutzt ein Solarkollektor auf dem Dach nichts, wenn er über Schneefläche trotz Bedarfs offline ist. Im Sommer hingegen er über das benötigte Maß liefert und der Pufferspeicher beflissen ist, nicht benötigte Wärme bestmöglich zu parken und sobald er voll ist, die Solarheizung in Stagnation gerät.
Auswahlfaktor Gestaltung
Flachkollektoren oder Röhren an die Fassade? Darüber streiten sich die Geister. Während die einen Röhrenkollektoren aus ästhetisch-architektonischen Gründen gar nicht an der Fassade sehen und sie verwerfen, heben die anderen Effizienzvorteile beziehungsweise gerade das technische Design der Röhrenkollektoren für bestimmte architektonische Einsatzbereiche hervor. Oft bleibt es eine Geschmacksfrage. Für Flachkollektoren spricht die größere architektonische Gestaltungsbandbreite.
Die Doma Solartechnik GmbH beispielsweise bietet Kollektoren an, die der Architekt in Farbe und Größe dem Gebäude anpassen und in die Fassade einpassen, also sozusagen nobel „verschwinden“ lassen kann. Die Kollektorgläser sind mit Beschichtungen versehen, die das Licht selektieren. Ein geringer, nach der Wellenlänge eingegrenzter Teil des Lichtspektrums wird auf dem beschichteten Glas reflektiert. Diese Reflexion erzeugt den Farbeffekt.
Aber auch die Anbieter von Röhrenkollektoren gehen mit der Farbe. Die AkoTec Produktionsgesellschaft mbH bietet die Möglichkeit an, aus 213 RAL-Farben die persönliche Wunschfarbe auszuwählen. In dieser Farbe werden dann der Sammlerkasten und auch das Fußteil ausgeliefert. Über das Fußteil kann der Kollektor von der Fassade überdies auf Wunsch abgestellt werden. Die Kollektoren können so zum Beispiel als Terrassenüberdachung oder als Überdachung von Hauseingängen genutzt werden.
Achtung Schattenwurf
Für Fassadenkollektoren, die besonders die tief stehende Sonne nutzen können, ist der Schattenwurf eine besondere Achillesferse, weil tief stehende Sonne bekanntlich lange Schatten wirft und aus Mäusen Elefanten macht. Bei der Planung sind nicht nur vorhandene Schatten ausfindig zu machen, sondern auch Schattenveränderungen zu berücksichtigen: Nachbars- oder Straßenbäume wachsen in den nächsten 20 Jahren, Baulücken können durch neue Gebäude geschlossen werden, die ihren Schatten dann aufs Haus werfen. Das Gleiche gilt für Beschattungsursachen, die im Gebäude selbst liegen, zum Beispiel Dachvorsprünge oder Dachüberstände.
Sicherheitsvorkehrungen
Was ist bei der Planung von Fassadenkollektoren weiter zu beachten? Bei Vertikalverglasungen ist die TRLV (technische Richtlinien für linienförmig gelagerte Verglasungen) zu beachten. Bei Montage über Verkehrsflächen sind Schutzeinrichtungen zur Vermeidung von Verletzungen von Personen vorzusehen, zum Beispiel Auffangwannen für Glasteile. Die Kollektorhalterung muss zum Wärmedämm-Verbundsystem passen, damit es durch Kältebrücken keine Schäden gibt. Die Frage nach der Leistungsgröße beantwortet schlussendlich nur die Simulation per Software.
Fazit: Interessant, möglicherweise besser
Es gibt nicht nur verschiedene rationale Gründe wie die Konkurrenz mit der PV, die auch zum Heizen aufs Dach ziehen wird, oder Fragen der Ästhetik. Solarwärmeanlagen an der Fassade eines Gebäudes zu montieren erleichtert auch, Erneuerbare optisch in ein Gebäude zu integrieren – eine wichtige Forderung zum Beispiel von Architekten. Rein ertragstechnisch sind Fassadenkollektoren eine interessante und möglicherweise auch bessere Solarthermie-Alternative, weil sie ihre Stärken gerade dann ausspielen, wenn Wärme besonders gefordert ist, nämlich im Winter.
Autor: Dittmar Koop, Fachjournalist
PV auf dem Vormarsch
„Solarstrom-Nachfrage 75 % über Vorjahr“ – so titulierte der Branchenverband Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) seine Mitteilung im August 2017. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden laut Bundesnetzagentur Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 900 MW errichtet, rund 75 % mehr als im Vorjahreszeitraum (515 MW). Gesunkene Anschaffungskosten führten laut BSW dazu, dass die Nachfrage nach Solarstromanlagen insbesondere bei mittelständischen Unternehmen in den letzten Monaten stark zugenommen hat. Doch auch ein Drittel mehr Eigenheimbesitzer setzten im ersten Halbjahr 2017 auf Solargeneratoren als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahrs.
Die Entscheidungen wurden auch über die Entwicklung bei den Preisen für Solarstromspeicher vorangetrieben. Laut BSW kosten kleine Speicher mit einer Nennkapazität bis 10 kWh rund 40 % weniger als noch vor 4 Jahren. Größere Speicher mit einer Nennkapazität bis 30 kWh sind sogar um mehr als 50 % günstiger geworden.
Die Produktion von Eigenstrom ersetzt den Fremdbezug von Strom. Über Speicher lässt sich die Eigenstromquote bis zu mehr als verdoppeln auf etwa 70 %. Perspektivisch werden zudem Elektroautos mit Eigenstrom versorgt und der Wärmebedarf eingebunden. Die viel beschriebene Sektorkopplung (Strom, Verkehr, Wärme) wird nicht nur im Großen, sondern auch auf der denkbar kleinsten Ebene stattfinden: dem Haus.