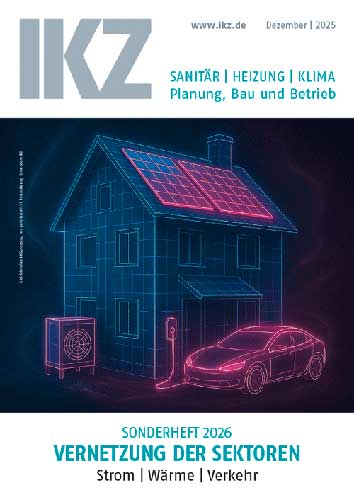Die Netze weniger verstopfen
Das Solarspitzengesetz – was es bedeutet und worauf es abzielt
Der Zubau an PV war auch im vergangenen Jahr in Deutschland dynamisch. SHK-Betriebe, Solarteure und Planer, die inzwischen auch PV in ihr Geschäftsmodell integriert haben und diese Leistung anbieten, sollten das Warum des Solarspitzengesetzes kommunizieren können und welche konkreten Auswirkungen es hat. (Solarwatt)
Erheblicher Zuwachs in den vergangenen beiden Jahren beim PV-Zubau: Nach ersten Prognosen des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) wuchsen die solaren Erzeugungskapazitäten 2024 erneut auf Rekordniveau. Insgesamt wurden laut BSW im vergangenen Jahr mehr als 1 Mio. Photovoltaikeinheiten neu in Betrieb genommen, rund 17 GW Leistung wurden zugebaut. (BSW Solar)
In der politischen Hängepartie seit November 2024 (Ampel brach auseinander) haben Union, SPD und Grüne Anfang des Jahres das „Solarspitzengesetz“ beschlossen, um Korrektive am EEG zu erwirken. Denn das EEG gilt inzwischen als ungenügend und praxisfern.
Im Gegensatz zum derzeit schwächelnden Heizungsmarkt hält der PV-Anlagen- und Solarstromspeicher-Boom in Deutschland an, auch wenn der Trend sich im vergangenen Jahr leicht abgeschwächt hat. Die vorläufigen Zahlen des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) zeigen, dass im vergangenen Jahr 17 Gigawatt (GW) PV-Leistung zugebaut wurden – diese Zahl ist schon enorm und noch einmal um rund 10 % höher als in 2023, dem Jahr, indem sich der Zubau im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft verdoppelte.
Die Krux der negativen Strompreise
Damit nimmt aber gleichsam das Kapazitätsproblem des Stromnetzes mit dem weiteren Zubau von Solarstromkapazität in GW-Größenordnung jedes Jahr mit jedem Sonnentag und insbesondere in der Mittagszeit zu. Das führt zu einem volkswirtschaftlichen Unsinn: Solarstrom wird auf der einen Seite mit einem Festsatz nach EEG bei Einspeisung ins Netz vergütet, für die Refinanzierung werden im Gegenzug an der Börse aber ggf. keine adäquaten Erlöse erzielt. Es gibt ggf. Negativpreise an der Strombörse aufgrund von AngebotsÜberschuss.
Was sind Negativpreise? Der Betreiber eines nach eigenen Angaben der größten virtuellen Kraftwerke in Europa, das Kölner EVU Next-Kraftwerke, beschreibt das so: „Sie [negative Strompreise, Anm. d. Red.] treten auf, wenn die Stromerzeugung den Stromverbrauch überschreitet. Wer bei negativen Marktpreisen Strom einspeist, erhält keine Erlöse, sondern muss für seinen eingespeisten Strom bezahlen. Negative Strompreise kommen meistens bei einer hohen Einspeisung von Strom aus Wind und Sonne und/oder einem geringen Stromverbrauch auf.“ Die Differenz zahlt am Ende der Endverbraucher über seine Strompreise, in Form der EEG-Umlage.
Kernpunkte des Solarspitzengesetzes
Es macht Sinn, möglichst viel vom selbst erzeugten PV-Strom auch selbst zu verbrauchen (Eigenstrom) bzw. zur späteren Verwendung zu speichern und die Netze zu entlasten. Aber es geht eben auch darum, negative Strompreise möglichst zu vermeiden und darüber die Schere zwischen staatlicher EEG-Vergütung und Refinanzierung an der Börse möglichst zu vermeiden bzw. möglichst klein zu halten. U. a. deshalb hat der Bundestag der nun vergangenen 20. Legislaturperiode auf den letzten Metern im Januar 2025 noch das sogenannte „Solarspitzengesetz“ beschlossen. Der erste wichtige Kernpunkt ist, dass die Einspeiseleistung von neuen PV-Anlagen (im Leistungsbereich 2 bis 25 kW, sofern sie noch nicht an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind), auf 60 % der Nennleistung gedrosselt wird (zur Relevanz dazu später mehr). Der zweite, dass die Vergütung für eingespeisten Solarstrom zu Zeiten negativer Strompreise an der Börse ausgesetzt und dann hintenan, nach Ablauf der 20 Jahre Vergütungszeitraum, über eine bestimmte Ausgleichsformel angehängt wird. Der Sachverhalt ist auch deshalb ernst zu nehmen, weil diese Ausgleichsformel schon für Zeiträume im Viertelstunden-Takt gilt (neue Viertelstundenvermarktung an der Strombörse). Wohlgemerkt, die Regelung gilt für alle neuen Anlagen, nicht für Bestandsanlagen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) erläutert: „Betreiber neuer Photovoltaikanlagen erhalten zukünft ig keine EEG-Vergütung mehr für den Strom, den sie zu Zeiten negativer Börsenstrompreise ins öff entliche Stromnetz einspeisen. In diesen Zeiten besteht ein Stromüberangebot. Damit dies die Rentabilität von neuen Solarstromanlagen nicht nennenswert beeinträchtigt, greift ein Kompensationsmechanismus: Die geförderte Solarstromeinspeisung, die zu Zeiten negativer Strompreise nicht vergütet wurde, kann durch eine Verlängerung des rund 20-jährigen Vergütungszeitraums nachgeholt werden.“
Weitere Aspekte
Auch Betreiber von bereits bestehenden Solarstromanlagen können auf freiwilliger Basis zu der Neuregelung optieren. Als Anreiz für einen freiwilligen Wechsel erhalten diese eine Vergütungserhöhung von 0,6 ct/kWh. Für Bestandsanlagen gelten laut BSW-Solar im Wesentlichen die Anforderungen zum jeweiligen Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
Die Einspeiseleistung – nicht gleichzusetzen mit der Einspeisemenge – von neuen Photovoltaikanlagen wird auf 60 % beschränkt, solange diese nicht mit einem intelligenten Messystem ausgestattet sind. Der BSW relativiert das aber in der Bedeutung: „Da inzwischen nahezu alle neu installierten Solaranlagen mit einem intelligent betriebenen Speicher betrieben werden, dürft en Betreibern dadurch in der Regel keine nennenswerten Nachteile entstehen. Solare Erzeugungsspitzen werden so nicht ins Stromnetz eingespeist, sondern entweder direkt vor Ort verbraucht, mit Hilfe von Speichern zeitversetzt vor Ort verbraucht oder zeitversetzt ins Netz eingespeist, wenn weniger Sonne scheint.“
Nur in den seltenen Fällen, so der BSW, bei denen neue Solarstromanlagen über keinen Speicher verfügten und den gesamten Strom ins öff entliche Netz einspeisen müssten, führe die beschlossene Kappung der Einspeiseleistung auf 60 % zu Abregelungs- und damit Rentabilitätsverlusten. Diese befinden sich dann laut BSW aber nur im unteren einstelligen Prozentbereich. Der Branchenverband schlüsselt das auch auf: In Lagen bester Sonneneinstrahlung würden sich die Verluste auf maximal 1 % bei Ost-West-Ausrichtung und auf maximal 9 % bei Südausrichtung einer Solaranlage belaufen. An weniger sonnenreichen Standorten würden die Verluste geringer ausfallen, so der BSW. Die Reduzierung der Einspeiseleistung auf 60 % gilt für alle Photovoltaiksysteme mit einer Leistung unter 100 kW (mit Ausnahme kleiner Steckersolargeräte), die nicht in der Direktvermarktung sind.
Fazit: Was bedeutet das perspektivisch?
Was bedeutet die Regelung perspektivisch? Vor dem Hintergrund dieser – sicher als sinnvoll anzusehenden ersten politischen Beschlüssen hinsichtlich EEG-Reformierung an den starken Ausbau am Markt – gilt es für den SHKler, TGAler und Solarteur, seinem Kunden noch mehr auf das Th ema Eigenstromnutzung hinzuweisen, wenn der Photovoltaik will. Die Eigenstromnutzung ist ohnehin das große Trendthema, aber jetzt geht es auch um die Frage, wie Solarstrom angepasster bzw. netzkompatibler genutzt bzw. gespeichert werden kann. Das macht den Einsatz von prognosebasierten Energiemanagementsystemen für die Beladung von Batteriespeichern noch aktueller.
Ein Hinweis zum Schluss: Über die aktuelle Stromspeicherstudie der HTW-Berlin berichten wir in der kommenden Ausgabe.
https://t1p.de/q6mvc Link zum BSW-Merkblatt zum Solarspitzengesetz oder per QR-Code.
https://t1p.de/fy2lb Link zum Solarspitzengesetz oder per QR-Code.
Autor: Dittmar Koop