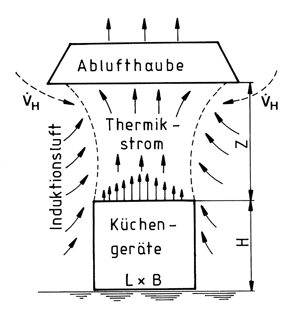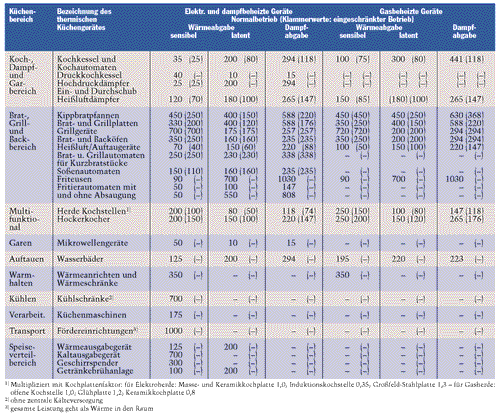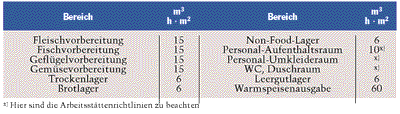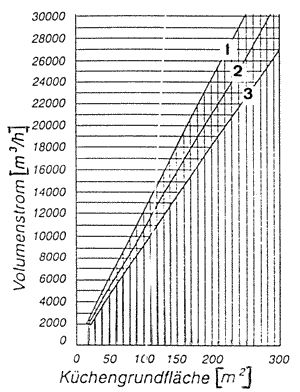IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 7/2002, Seite 30 ff.
SANITÄR-/HEIZUNGSTECHNIK
Grundlagen der Küchenlüftung
Teil 2: Ermittlung der Luftströme
Claus Ihle
Die Notwendigkeit und Aufgaben einer Küchenlüftung wurden im ersten Teil dieser Artikelfolge aufgezeigt. Im folgenden zweiten Teil befasst sich der Autor mit den unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen.
Ermittlung der Luftströme
Für die Auslegung der Küchenlüftung steht die Berechnung der Luftströme an erster Stelle. Dabei unterscheidet man zwischen folgenden drei Auslegungsgrößen:
a) Erfassungsluftstrom ![]() , der so zu bemessen ist, dass die Stoffe die oberhalb der Kochstelle entstehen, möglichst vollständig erfasst werden. Grundlegend für
, der so zu bemessen ist, dass die Stoffe die oberhalb der Kochstelle entstehen, möglichst vollständig erfasst werden. Grundlegend für ![]() ist die Berechnung des Thermikluftstroms.
ist die Berechnung des Thermikluftstroms.
b) Zuluftvolumenstrom, der nach den aus dem Arbeitsbereich abzuführenden Wärme- und Stofflasten zu bemessen ist. Dabei müssen die Stoffgrenzwerte und die thermischen Anforderungen eingehalten werden.
c) Abluftvolumenstrom (Raumabluft), der sich aus dem Unterschied zwischen dem Zuluftvolumenstrom und dem an der Erfassungseinrichtung fortgeführten Luftstrom ergibt.
Für die Ermittlung aller drei Luftströme liegen die in Tabelle 3 angegebenen Wärme- oder Stofflasten zugrunde.
Thermikluftstrom 
Der Thermikluftstrom, d.h. der Warmluftstrom oberhalb der Küchengeräte (Kochstellen), entsteht durch den Temperatur- und Dichteunterschied als freie Konvektionsströmung und induzierte Luft aus der Umgebung (Bild 5). Maßgebend für den Strömungsverlauf ist der konvektiv übertragene Anteil an der sensiblen Wärmebelastung ![]() der Küchengeräte der wie folgt berechnet wird.
der Küchengeräte der wie folgt berechnet wird.
| Bild 5: Thermikluftstrom |
![]() = P ·
= P · ![]() · b · j in Watt
· b · j in Watt
P = Leistung der Geräte in kW
![]() = sensible Wärme aus Tabelle 3 in W/kW
= sensible Wärme aus Tabelle 3 in W/kW
b = Konvektionsanteil = 0,5
j = Gleichzeitigkeitsfaktor aus Tabelle 1
In Tabelle 3 wird der Normalbetrieb zugrunde gelegt, der eine wirtschaftliche Betriebsweise voraussetzt. Falls davon abweichend Nutzungen vorliegen (z.B. länger geöffnete Kesseldeckel beim Garen) müssen gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. Die eingeschränkte Betriebsweise gilt für die Teillastberechnung. Der Thermikluftstrom (![]() ) kann anhand Bild 4 grafisch ermittelt werden, wobei folgende Gleichung zugrunde liegt:
) kann anhand Bild 4 grafisch ermittelt werden, wobei folgende Gleichung zugrunde liegt:
![]() = k ·
= k · ![]() 1/3 · (z + 1,7 · dh)5/3 in m3/h
1/3 · (z + 1,7 · dh)5/3 in m3/h
k = konstanter empirisch ermittelter Wert = 18m 4/3. w -1/3. h-1
z = Höhenabstand zwischen Oberkante Kochfläche und Unterkante Haube, d.h. die freie Weglänge des Thermikstrahls
dh = hydraulischer Durchmesser = 2·L·B/(L+B), wobei L die Länge und B die Breite in m der Wärmequelle (Küchenblock) bedeutet.
Beispiel: In der Küchenmitte einer Gaststätte wird ein 4,5 m langer und 1,8 m breiter Küchenblock vorgesehen. Hierfür sind folgende Geräte mit angegebener elektrischer Leistung vorgesehen: Verschiedene Kochkessel mit insgesamt 60 kW, Kippbratpfannen 12,8 kW, Friteuse 11,4 kW, Druckkochkessel 27,7 kW Heißluftdämpfer 24,3 kW. Der Abstand zwischen den Wärmequellen (Küchenblock) wird mit 1,2 m angegeben.
a) Wie groß ist der Thermikluftstrom, wenn beim Normalbetrieb ca. 200 Essensportionen zubereitet werden?
b) Um wie viel Prozent reduziert sich der Thermikluftstrom, wenn die Aufstellung des Küchenblocks einseitig an der Wand aufgestellt wird?
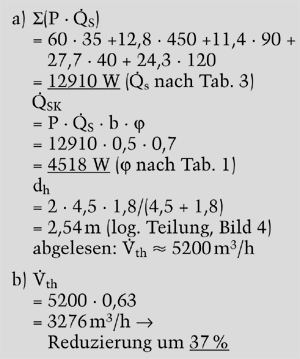
Anmerkung: Je nachdem, wie die Wärmequelle angeordnet ist, ergeben sich beachtliche Minderleistungen beim Thermikstrom, die in Bild 4 als Faktoren angegeben werden. Im Gegensatz zur freien Aufstellung, bei der der Thermikstrom als isothermer Freistrahl betrachtet werden kann (Faktor 1,0), legt sich bei der Geräteanordnung an der Wand der Thermikstrom an die Wand an. Dieser "Wandstrahl" induziert wesentlich weniger Luft als der Freistrahl.
| Tabelle 3: Wärme- und Stofflasten von Küchengeräten |
Erfassungsluftstrom![]()
Der Erfassungsluftstrom ist so zu bemessen, dass alle oberhalb der Kochstelle entstehenden Stoffe möglichst vollständig erfasst werden. Grundlegend sind die abzuführenden Wärme- oder Stofflasten aus dem Arbeitsbereich, wobei die Stoffgrenzwerte und die thermischen Anforderungen eingehalten werden müssen. Wird die Abluft aus dem Raum über Ablufthauben vorgenommen, ergibt sich ![]() aus dem Thermikluftstrom an der Unterkante der Erfassungseinrichtung gemäß Bilder 4 und 5.
aus dem Thermikluftstrom an der Unterkante der Erfassungseinrichtung gemäß Bilder 4 und 5.
Tabelle 4: Ausspülgrade
Strömungsform | Ausspülgrad |
Mischströmung | |
- Tangentialdurchlässe | 1,25 |
- Deckenluftdurchlässe | 1,20 |
Schichtströmung | |
- Deckendurchlässe | 1,10 |
- Auslässe im Arbeitsbereich | 1,05 |
Der Erfassungsluftstrom ist allerdings nur theoretisch mit dem Thermikluftstrom identisch, da er in der Regel noch korrigiert bzw. ergänzt werden muss. Hierzu drei Möglichkeiten:
a) Je nach der gewählten Luftführung bzw. je nach Art der Zuluftzufuhr kann der Thermikstrom ![]() unterschiedlich gestört werden, indem es zu so genannten Ausspülungen kommen kann. Dies wird durch den Ausspülgrad a berücksichtigt (Tabelle 4), der für Ablufthauben und Abluftdecken eingesetzt wird. Demnach ist:
unterschiedlich gestört werden, indem es zu so genannten Ausspülungen kommen kann. Dies wird durch den Ausspülgrad a berücksichtigt (Tabelle 4), der für Ablufthauben und Abluftdecken eingesetzt wird. Demnach ist:
![]() =
= ![]() · a
· a
Bei den Angaben in Tabelle 4 handelt es sich zwar nur um Anhaltswerte, trotzdem wird auch hier der Vorteil der Schichtströmung deutlich.
b) Zur Verbesserung der Erfassungswirkung (Ausspülgrad a) und somit zur Stabilisierung der Strömung, kann man direkt in die Ablufthaube Luft einblasen (gestrichelte Pfeile ![]() in Bild 5). Damit errechnet sich der Erfassungsstrom wie folgt:
in Bild 5). Damit errechnet sich der Erfassungsstrom wie folgt:
![]() =
= ![]() · a +
· a + ![]()
wobei die Bilanz aus ![]() und
und ![]() an der Erfassungseinrichtung ausgeglichen sein muss.
an der Erfassungseinrichtung ausgeglichen sein muss.
c) Wenn bei Gar- oder Kochprozessen der Latentanteil größer als der sensible Anteil ist, kann man den Differenzluftstrom ohne Erhöhung des Erfassungsluftstroms nach Bild 4 direkt in die Haube einblasen. Hierzu kann man auch unaufbereitete Außenluft verwenden. Wie nachfolgend erläutert, muss der Abluftvolumenstrom nach dem größten Lastanfall (sensibel oder latent) berechnet werden.
d) Werden Gasgeräte verwendet, muss noch der Abgasstrom berücksichtigt werden, der näherungsweise wie folgt berechnet werden kann:
![]() = 1,35 · P · j
= 1,35 · P · j
Abluftvolumenströme - Zuluftstrom
Der Abluftstrom aus der Küche setzt sich zusammen aus der Summe aller Erfassungsluftströme S ![]() an den Hauben oder sonstigen Erfassungseinrichtungen und dem Luftstrom
an den Hauben oder sonstigen Erfassungseinrichtungen und dem Luftstrom ![]() , ne (ne = nicht erfasst), d. h. den durch Thermik bewegten Luftstrom bis 2,5 m über Fußboden für die Wärmequellen, die nicht unter der Haube angeordnet sind. Er kann ebenfalls nach Bild 4 ermittelt werden und ist an der Raumdecke abzuführen. Auch
, ne (ne = nicht erfasst), d. h. den durch Thermik bewegten Luftstrom bis 2,5 m über Fußboden für die Wärmequellen, die nicht unter der Haube angeordnet sind. Er kann ebenfalls nach Bild 4 ermittelt werden und ist an der Raumdecke abzuführen. Auch ![]() muss durch den Ausspülgrad a korrigiert werden, so dass hier
muss durch den Ausspülgrad a korrigiert werden, so dass hier ![]() = S
= S ![]() +
+ ![]() , ne · a ist. Falls
, ne · a ist. Falls ![]() , ne 10% geringer als die Abluftströme an den Hauben ist, muss zusätzlich zur Absaugung an der Raumdecke ein Ausgleichsstrom
, ne 10% geringer als die Abluftströme an den Hauben ist, muss zusätzlich zur Absaugung an der Raumdecke ein Ausgleichsstrom ![]() angesetzt werden, sodass
angesetzt werden, sodass ![]() , ne +
, ne + ![]() größer als
größer als ![]() größer als 0,1 ·
größer als 0,1 · ![]() ist.
ist.
Anmerkungen:
- Den erforderlichen Abluftstrom in Verbindung mit Küchenabluftdecken bestimmt man aus dem durch Thermik bewegten Luftstrom ![]() bis 2,5 m über Fußboden gemäß Bild 4. Auch hier müssen die Störungen der Luftströmungen über den einzelnen Herdblöcken durch den Ausspülgrad a korrigiert werden:
bis 2,5 m über Fußboden gemäß Bild 4. Auch hier müssen die Störungen der Luftströmungen über den einzelnen Herdblöcken durch den Ausspülgrad a korrigiert werden:
![]() = a · S
= a · S![]()
In den Fällen, bei denen im Küchenbetrieb ein großer Wasserdampfanfall zu erwarten ist, sollte man den Abluftvolumenstrom nach der in Tabelle 3 angegebenen Wasserdampfabgabe bestimmen. Diese - unabhängig von der Art der Abluftabführung - vorgenommene Kontrollrechnung soll nämlich zeigen, ob der Abluftvolumenstrom nach der sensiblen oder latenten Wärmeabgabe festzulegen ist; der größere wird gewählt.
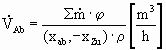
![]() = Wasserdampf in g/h
= Wasserdampf in g/h
(xAb - xZu) = 6 g / kg;
jedoch xAb<16,5 g / kg
![]() 1,2 kg / m3
1,2 kg / m3
Zuluftvolumenstrom![]()
Der Zuluftstrom wird nach den berechneten Abluftvolumenströmen bestimmt, d. h. maßgebend sind auch hier die abzuführenden Wärme- und Stofflasten aus dem Arbeitsbereich:
![]() = S
= S![]() bzw. = S
bzw. = S![]() +
+ ![]() , ne +
, ne + ![]()
![]() soll gleich dem Abluftvolumenstrom sein, damit zwischen Küche und den angrenzenden Räumen der Druckausgleich gewährleistet ist.
soll gleich dem Abluftvolumenstrom sein, damit zwischen Küche und den angrenzenden Räumen der Druckausgleich gewährleistet ist.
| Tabelle 5: Volumenströme für Nebenräume |
Überschlägige Luftströme und Anhaltswerte für Nebenräume
Aus Bild 4 ist ersichtlich, dass zur genauen Berechnung der Volumenströme mehrere Angaben erforderlich sind. Sind solche nicht vorhanden, kann anhand Bild 6 eine überschlägliche Bemessung der Küchenlüftung vorgenommen werden, die allerdings nur als Abschätzung bei der Vorplanung dienen darf. Die Ausführungsplanung verlangt eine detaillierte Berechnung. Zur Volumenstrombestimmung für Nebenräume, können die Anhaltswerte aus Tabelle 5 entnommen werden.
| Bild 6: Überschlägige Volumenstromberechnung: 1) Brat-, Grill- und Backbereich, 2) Koch- und Garbereich, 3) Gesamter Küchenbereich. |
Eine Geruchsausbreitung innerhalb des Gebäudes muss durch Abluft verhindert werden, die in geeigneten angrenzenden Räumen abgesaugt wird. Grundsätzlich muss ein Nachströmen von Luft aus hygienisch bedenklichen Räumen verhindert werden. Fortsetzung folgt.
[Zurück] [Übersicht] [www.ikz.de]